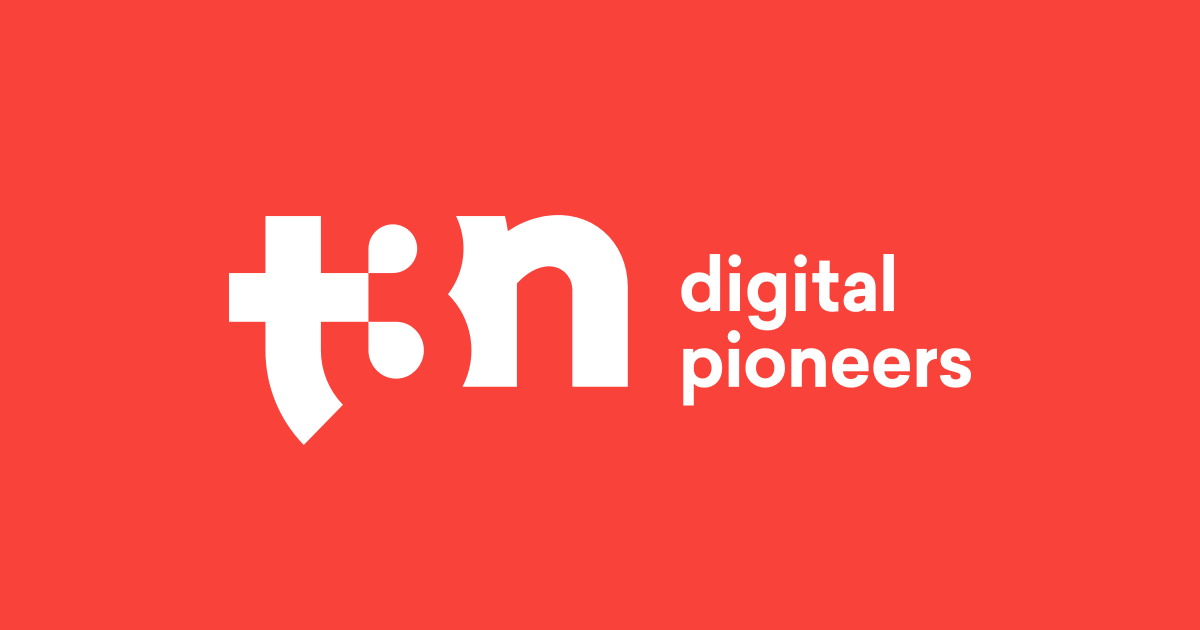Wo hakt’s bei der Digitalisierung im Gesundheitssystem?
PDF statt eines ausgedruckten Dokuments, Videocall statt Meeting: In der Arbeitswelt setzt sich die Digitalisierung immer mehr durch. Im Gesundheitswesen scheint das Ganze etwas komplizierter zu sein. Was ist da los – und was muss sich ändern?
Bianca Kastl ist Entwicklerin und hat die Digitalisierung von Gesundheitsämtern seit Beginn der Coronapandemie begleitet. Wir haben die t3n-Kolumnistin nach dem Status quo der Digitalisierung im Gesundheitswesen gefragt und mit ihr darüber gesprochen, was nötig ist, um digitale Lösungen zu etablieren.
Empfehlungen der Redaktion
t3n: INÖG, DVG, GDNG – wer sich zum ersten Mal mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigt, wird von bürokratischen Abkürzungen erschlagen. Wie würdest du die Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland zusammenfassen?
Bianca Kastl: Das digitale Gesundheitswesen ist ein ziemlich zersplittertes Feld mit verschiedenen Akteur:innen. Dazu gehören zum Beispiel Krankenhäuser, Ärzt:innen, der öffentliche Gesundheitsdienst, Krankenkassen und andere Dienstleister:innen. All diese Akteur:innen müssen mit ihren organisatorischen Strukturen bei der Digitalisierung eingebunden werden. Dabei arbeiten sie mal mit-, mal gegeneinander, weil sie jeweils ihre ganz eigenen Interessen haben.
t3n: Welche Interessen sind das?
Früher war es so: Ich hatte zum Beispiel mit meiner Hausärztin eine Vertraulichkeit und wusste, dass meine Akte bei ihr im Safe sicher verwahrt war.
Mittlerweile entwickelt sich das Gesundheitswesen immer mehr in Richtung Forschung, Vernetzung und digitale Medizin. Hier kommen viele Parteien ins Spiel, die nicht mehr ins klassische Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt:in und Patient:in passen.
Bianca Kastl weiß, wo es bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen immer wieder hakt – und welche Chancen es gäbe. (Foto: Bianca Kastl)
Krankenkassen wollen Einblick in die elektronische Patientenakte, um maßgeschneiderte Angebote zu liefern, Forschungsinstitute wollen pseudonymisierte Daten zur Forschung nutzen und die Macher:innen von digitalen Gesundheitsanwendungen wollen eine Vernetzung mit der Akte.
Das alles hatten wir so vor 20 Jahren noch nicht.
t3n: Viele Prozesse im Gesundheitswesen wirken träge und in die Jahre gekommen. Was ist nötig, um Faxgeräte und Co. endlich abzulösen?
Aktuell gibt es da ein Paradox. Wir sind es gewohnt, digital zu leben und zu arbeiten, aber das digitale Gesundheitswesen mitsamt seiner technischen Infrastruktur kommt noch aus einer Zeit, in der die Dokumente von Menschen, die in einer Arztpraxis versorgt wurden, zwar digital, aber eben nur in der Praxis verwahrt wurden.
Die Grundlagen der Telematikinfrastruktur der Gematik stammen aus dem Jahr 2005! Mittlerweile ist digitale Gesundheit viel flexibler und mobiler geworden. Wir brauchen also Technologien, die tatsächlich auch im Jetzt angekommen sind. Weg von den ominösen Konnektoren, die eine Art bessere Router für Arztpraxen sind, hin zu Lösungen, die die Leute da abholen, wo sie sind – also zum Beispiel Videosprechstunden und Apps.
t3n: Ideen, wie man im Zeitgeist ankommen könnte, gibt es ja durchaus, zum Beispiel mit der elektronischen Patientenakte. Bei der Einführung hapert es dann aber immer wieder. Was ist da los?
Wir haben in Deutschland ein ganz typisches Problem: Unsere technischen Lösungen sind für die Zeit, in der sie entstehen, meist sogar relativ fortschrittlich. Aber irgendwie schaffen wir es dann nicht, die Anwendungen und Tools an die Leute zu bekommen. Sowohl im Gesundheitswesen, als auch in der Verwaltung gibt es gute Lösungen – es scheitert am Roll-out. Ein Beispiel dafür ist die Gesundheitskarte mit Pin. Die sollten mittlerweile eigentlich die meisten Bürger:innen haben, die Pin ist aber längst nicht bei allen angekommen.
t3n: Gibt es einen konkreten Flaschenhals, an dem es immer wieder scheitert?
Da passen verschiedene Dinge nicht zusammen. Die meisten Projekte laufen nach dem folgenden Schema: Am Anfang gibt es eine Spezifikation, also gewisse Rahmenvorgaben. Die werden im Gesundheitsbereich häufig von der Gematik ausgearbeitet.
Die Spezifikation kann aber noch so gut sein, letztendlich kommt es darauf an, wie Hersteller oder Krankenkassen sie interpretieren und umsetzen. Das läuft nicht immer ideal, und dazu kommt dann noch der Roll-out. Eine möglicherweise gute Idee, die am Anfang stand, wird also durchs Interpretieren und Ausrollen verwässert und führt in der Praxis immer wieder zu Problemen.
Aus meiner Sicht würde es helfen, die Gesamt-Experience, also wie sich zum Beispiel die Interaktion mit der digitalen Patientenakte anfühlen soll, noch stärker in den Fokus zu stellen und zu standardisieren. Dabei ist der Föderalismus im Gesundheitssystem aber nicht gerade förderlich.
t3n: Wenn man über Digitalisierung im Gesundheitssystem spricht, darf das Thema Datenschutz natürlich nicht fehlen – es geht schließlich um ziemlich sensible Angaben. Sind die zunehmende Vernetzung und der Schutz von Daten gegensätzliche Interessen?
In Deutschland haben wir teilweise so eine heftige Diskussion über Digitalisierung und Datenschutz, weil in der Frustration darüber, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten nicht funktioniert, Schuldige gesucht werden. Da findet dann die Projektion statt: Es ging nicht wegen des Datenschutzes. Das halte ich für falsch.
Beim Datenschutz geht es nicht darum, die Daten an sich zu schützen, sondern die Grundrechte der Menschen, zu denen die Daten gehören. Diese Grundrechte sind ein wichtiges Gut, da geht es zum Beispiel um Möglichkeiten, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen oder eine Löschung zu beantragen. Es ist ein bisschen wie in der Medizin: Vor einer Operation werde ich ja auch aufgeklärt, was passiert, man weist mich auf Risiken hin und ich kann mich dann dafür oder dagegen entscheiden.
Datenschutz und IT-Sicherheit stehen der Durchführung von Projekten nur dann im Weg, wenn man sie nachgelagert sieht. Wir müssen dahin kommen, dass sie von Anfang an mitgedacht werden. Und es gibt ja auch Beispiele, in denen das mit der Datenautonomie ganz gut funktioniert – zum Beispiel bei Apple Health.
t3n: Welche Wege gibt es denn, diese Autonomie gut zu schützen, aber trotzdem mit Daten für das Gemeinwohl zu forschen?
Bei vielen Forschungsfragen halte ich es für möglich, nicht einfach Daten auszutauschen, sondern Forschungsdialoge zu führen. Die gibt es normalerweise auch bei Medikamententests. Man sucht sich eine Gruppe an Testpersonen, mit der man arbeiten möchte, und stellt dann sehr genaue Fragen. Für die Menschen ist dabei transparent sichtbar, welche Daten sie übermitteln und was am Ende daraus gemacht wird – der Dialog steht dem Schutz von Daten also nicht im Weg.
Der Trend in der Forschung ist derzeit aber ein anderer: Big Data steht im Vordergrund, Forschungsdaten werden häufig zentralisiert und pseudonym ausgewertet. Das ist einfacher für die Forschenden, aus meiner Sicht aber ein Fehler. Die Forschung rückt damit weiter von den Menschen weg – obwohl wir eigentlich das Gegenteil bräuchten. Menschen müssen stärker in Forschungsprozesse involviert werden, die Ergebnisse mitgeteilt bekommen und den Nutzen davon sehen.
t3n: Stichwort „die Menschen involvieren“: Wie steht es in Deutschland um die Aufklärung bei Digitalprojekten im Gesundheitsbereich?
Wir haben da eine Lücke, von der ich persönlich noch nicht weiß, wer sie schließen wird. Die elektronische Patientenakte soll 2025 bei 80 Prozent der gesetzlich Versicherten verbreitet sein. Das ist, wenn wir die Software-Seite betrachten, ein riesiger Roll-out-Prozess für annähernd 60 Millionen Bürger:innen.
Wenn von diesen 60 Millionen nur zehn Prozent Fragen zur elektronischen Patientenakte haben, müssten wir eigentlich Hilfe für ein paar Millionen Bürger:innen anbieten. Die Krankenhäuser und Hausärz:tinnen haben aber weder Zeit noch Personal dafür – also läuft es aktuell eher so: Hier ist die Technik, wir lassen sie für sich selbst sprechen und setzen darauf, dass das funktioniert. Tut es aber nicht, die Verbraucher:innen werden alleingelassen – und wie soll dann jemand Lust haben oder befähigt werden, die digitalen Möglichkeiten selbstbestimmt zu nutzen?
t3n: Wer wäre denn in der Verantwortung, aufzuklären?
Üblicherweise wäre es technisch betrachtet die Pflicht derer, die das System betreiben. Bei der elektronischen Patientenakte wären das die Krankenkassen, rein formell gesehen.
Allerdings halte ich es für wesentlich sinniger, das Thema digitale Gesundheitskompetenz von individuellen Krankenkassen losgelöst zu sehen, weil es ein für uns alle notwendiges, allgemeines Skillset im digitalen Zeitalter werden wird. Das wäre dann eher eine Aufgabe, die auch Gesundheitsämter oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung begleiten könnten. Allerdings setzt das entsprechende Mittel voraus und die Erkenntnis, dass wir ansonsten ein Problem mit digitaler Gesundheitskompetenz in Zukunft bekommen werden.
Was würdest du dir für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens wünschen?
Es gibt in der Medizin immer noch eine akademische Fallhöhe. Mit der Digitalisierung bekommen wir die Chance, Medizin nahbarer und transparenter zu machen. Ich wünsche mir, dass wir Tools entwickeln, die mit den Patient:innen auf Augenhöhe sind, und nicht nur bessere Abrechnungssysteme für die Krankenkassen. Die Prämisse muss sein: Wir orientieren uns an den Menschen – auch wenn wir dafür die ein oder andere bestehende Struktur auf den Kopf stellen müssen.